Dieser Text hätte eigentlich ein anderer werden sollen. Einer, der mit kleinen Stadtgeschichten zu tun hat und das, obwohl ich weder Ethnologe noch Journalist bin. Ich habe über die vietnamesischen Änderungsschneidereien Berlins schreiben wollen, aus dem einzigen und banalen Grund, dass es so viele davon gibt. Daniel Miller, ein britischer Anthropologe, hat vor einigen Jahren mit seinem „Trost der Dinge“ eine Feldstudie veröffentlicht, die eigentlich keinem egal sein darf, der durch die Großstadt geht und darüber erzählt. Miller war es darum gegangen, im London von heute zu untersuchen, wie Menschen sich zu den Objekten ihres Alltags verhalten. Beinahe anderthalb Jahre lang hat er verschiedene Wohnungen im Süden der Stadt besucht und geschaut, was sie besitzen und was es ihnen bedeutet. Über diese Ding-Geschichten hinaus, so also die Idee, wird immer auch etwas Persönliches erzählt.
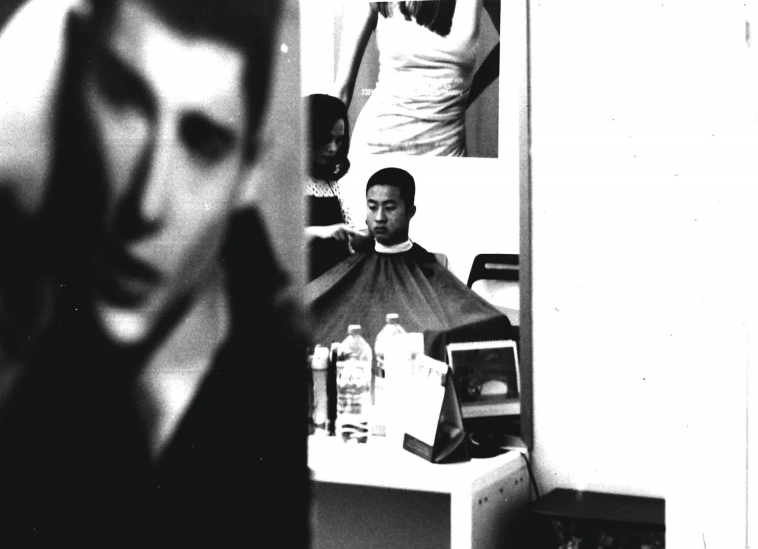
Und – das ist das Schöne, was all jenen, die bekümmert davon sprechen, dass der Konsum das Zwischenmenschliche zerstört, vielleicht etwas sauer aufstößt – die Geschichten funktionieren zunächst einmal ungeachtet des sozialen Status, der Herkunft oder der Zeit in der wir sie erzählen. Es war wohl sehr naiv, zu denken, dass es einfach wäre, etwas über die Lebensumstände der Besitzer in vietnamesischen Änderungsschneidereien zu erfahren. Ich bin in insgesamt fünf oder sechs Läden gewesen und habe eigentlich überall den Eindruck gehabt, dass die Leute, in allen Fällen waren das Frauen mittleren Alters, nicht reden wollten, dass es ihnen sogar unangenehm gewesen ist. Je mehr ich darüber nachdachte, desto einleuchtender fand ich das.
Aus unserer Sicht, also der Sicht junger Studierender, die ein Magazin machen, weil sie Lust dazu haben, ist es irgendwie erst einmal absurd, sich vorzustellen, dass da jemand nicht reden möchte. Es ist ja nichts weiter dabei, die Magazine sehen schön aus, Leser kennen bestenfalls ein paar neue Änderungsschneidereien, in die sie beim nächsten Mal ihre Jacke mit kaputtem Reißverschluss bringen.
Diese Ökonomie geht aber nichts auf, weil sie, das jedenfalls glaube ich ist der Grund, gar nichts mit der Lebenswelt dieser Menschen zu tun hat. Ob es gut oder schlecht ist, dass es in Berlin (und allen möglichen anderen Städten auf dieser Welt) unzählige dieser kleinen Orte gibt, in denen Menschen leben, die unsere Nachbarn sind, und über die wir unserem subjektiven Empfinden nach viel viel weniger wissen, als über den jungen Mann aus der ersten Etage, kann und will ich nicht beantworten. Aber ich kann es verstehen, denn so wie es keinen Grund gibt, nicht zu reden, so gibt es ebenso wenig einen, es zu tun.
Keine schöne Gegend

Nun, ohne Gespräche und Geschichten lässt sich nichts erzählen und so musste ich einen Ort finden, der gern etwas über sich preisgibt. Die Formulierung mag irritierend sein, aber tatsächlich ist es auch im Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg nicht weniger einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dennoch: Seit ich im März vor zwei Jahren zum ersten Mal dort gewesen bin, hat sich einiges geändert. Nicht im Dong Xuan Center selbst. Man fährt noch immer mit der M8 bis zur Herzbergstraße, keine Gegend, die Menschen, die den Rosenthaler Platz, die Seitenstraßen um die Warschauer Straße oder den Körnerpark in Neukölln mögen, schön nennen würden.
Die Hallen selbst erinnern an große Gewächshäuser oder Lagerhallen, wie man sie ab und an sieht, wenn man mit dem Zug ein Stück aus Berlin rausfährt. Verändert hat sich indes die Art und Weise, wie über das Center berichtet wird. Die Zeit hat im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass die Vietnamesen im Dong Xuan Center verkaufen „was ihnen gefällt, ohne Rücksicht auf die Vorlieben der Deutschen“. Das klingt ein wenig so, als könne man hier eine Art von Exotik erleben, die mit dem, was außerhalb passiert, wenig gemein hat. Exotik ist für eine Stadt wie Berlin wichtig und gut, weil sie noch stets davon zeugt, dass einen das Fremde im Eigenen interessiert. Insofern verwundert es nicht, dass man in den Hallen des Centers ab und an junge, gut gekleidete Menschen trifft, die auf der Suche nach Gemüse oder Gewürzen sind, die man im Rest der Stadt nur schwer bekommen würde. Oder dass eine Bekannte kürzlich davon sprach, sie wolle gern mal einen Sonntagsausflug „in dieses Center da machen, wo man alles bekommt“.
Kurzum: Ich schaue mir die Innereien und das in ehemaligen Limonadenflaschen abgefüllte Tierblut gern an, aber kaufen möchte ich diese Dinge dann vielleicht doch nicht. Das ist auch nicht weiter wild, denn die alte Formel davon, dass der Bauer nicht frisst, was er nicht kennt, hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, aber es rückt doch zumindest die Euphorie, die bisweilen an den Tag gelegt wird, wenn wir von exotischen Dingen sprechen, in ein etwas anderes Licht. Eine kleine Fußnote, die man hier wenigstens kurz erwähnen kann, ist die Tatsache, dass Ende Dezember das Deutsche Tierschutzbüro beim Gang durch das Center auf Wasserbecken mit Karpfen gestoßen ist. Die-se werden im Dong Xuan Center lebendig verkauft, damit die Kunden sie daheim selbst töten und ausnehmen können. Das Tierschutzbüro hat in Folge dieser Entdeckung Anzeige gegen das Center erstattet.
Nun habe ich bislang eigentlich nur von den Stellen gesprochen, an denen man exotische Lebensmittel finden kann. In der Mehrheit aber werden im Dong Xuan Center nicht Schlangenbohnen, Pak Choi oder Bananenblüten verkauft, sondern Turnschuhe, Hosen, Pullover, Accessoires oder Kunstblumen. Der Raum 810 in Halle 8 ist vollgestapelt mit grauen Hosen und neonfarbenen Pullovern, es riecht nach Chemie und man fragt sich, wie man es tagtäglich mehrere Stunden lang in diesem Dunst aushalten kann. Ein ähnliches Bild bietet sich wieder und wieder, je weiter man die Gänge entlang geht: Es gibt hier mehr, als das Auge vertragen kann, und das von nahezu allen alltäglichen Gebrauchsgegenständen.
Ein Mann mittleren Alters, der mit seinen drei Töchtern zum Einkauf gekommen ist, trägt Tüten voller Sportsachen aus einem Geschäft, nebenan sitzt ein älterer Herr bei der Maniküre. Einige Schritte weiter, vor ein paar Deutschlandfahnen, die es hier für drei Euro gibt, erklärt ein Mann seinem Begleiter: „Ick jeh hierhin zum Haareschneiden, Klamotten würd ich hier ooch nicht koofen, die sind zu billig jemacht.“ Neben ihm wackelt eine Gute-Laune-Blume im immer selben Rhythmus hin und her – es ist ein skurriles Bild und ein trauriges ist es auch, weil es hier ganz offensichtlich nicht darum geht, ein Stück vietnamesische Kultur kennenzulernen, sondern darum, all die Dinge, die Cafés, Restaurants und Geschäfte benötigen, in Massen und für sehr wenig Geld zu verkaufen.
Klamotten aus Tschechien
Hergestellt sind viele dieser Sachen in Tschechien und irgendwie erinnern die Szenen, die man im Dong Xuan Center beobachten kann, gar nicht so selten an jene, wie sie an der deutsch-tschechichen Grenze jeden Tag passieren. Ich bin dort als Kind ab und an mit meinen Großeltern gewesen, es hieß dann, wir machen einen aufregenden Ausflug, in Wahrheit ging es natürlich darum, günstige Anziehsachen und ein Mittagessen für drei Mark zu bekommen. Ich fand es ab dem Alter, in dem man beginnt, solche Dinge ein wenig zu reflektieren, unheimlich irritierend, dass meine Großeltern zugleich die ersten waren, die abends vor dem Fernseher über die vielen Ausländer in Deutschland schimpften.

Hier wie dort ist der Status, den das, was wir fremd nennen, hat, ein etwas eigentümlicher. Solange es nützlich ist, ist es okay, sobald es um Wertschätzung geht, geht die Gleichung nicht mehr auf. Kultureller Austausch hat, drastisch gesagt, eben genauso wenig mit dem Dong Xuan Center zu tun, wie mit dem deutsch-tschechischen Grenzübergang oder dem Luxusdampfer, der reiche Passagiere durch die Karibik fährt und nach unentdeckten, indigenen Völkern Ausschau halten lässt.
Man muss sich darüber nicht aufregen, aber man kann es zumindest feststellen und versuchen einzuordnen.
Auf der Homepage des Dong Xuan Centers findet sich ein Zitat des CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Klimke, der sagt: „Dieser gelebte kulturelle Austausch zwischen Deutschen und Vietnamesen ist eine wahre Erfolgsgeschichte deutscher Integrationspolitik und muss daher besonders hervorgehoben werden.“ Über diesen Satz, aber auch über die Geschichte des Dong Xuan Centers und die Pläne, die die Stadt Berlin hat, um Lichtenberg nach und nach zu einem deutsch-vietnamesischen Begegnungspunkt zu etablieren, hätte ich mit dem Leiter, Nguyen van Hien, gern persönlich gesprochen. Darum habe ich meine Telefonnummer und eine Ausgabe unseres Magazins bei seiner Sekretärin hinterlegt mit der Bitte, uns doch ein Interview zu ermöglichen.
Gemeldet hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten aber niemand.
Dieser Artikel ist in der zweiten Ausgabe des komplett selbstfinanzierten DILEMMA-Magazins erschienen. Bestelle Sie dir hier im Kaufladen.